Informatik -- Fortsetzung Wissenschaftliches Rechnen -- Lehrveranstaltung vom 15.04.2024
(EN google-translate)
(PL google-translate)
Themen
|
1. Wiederholung und Vertiefung zu Datentypen
QUIZ: Mit einer Vairable welchen Datentyps würden Sie jeweils die folgenden Datenelemente speichern?:
1) 42 2) 'A' 3) 0.5 4) true
Code 0-1: Datenelemente
|
double vektor[2]; vektor[0] = 1.2; vektor[1] = -0.9;
Code 0-2: double-Array
|
 10_Informatik1/06_Anwendungsgebiete/01_Simulationstechnik
10_Informatik1/06_Anwendungsgebiete/01_Simulationstechnik
|
2. Wiederholung und Vertiefung zu Kontrollstrukturen
|
//if-Anweisung
if(x>7)
{
cout<<"x ist groesser als 7."<<endl;
}
//while-Schleife
while(x<5)
{
x++; //Postinkrement-Operator, erhöht x um +1.
cout<<"x="<<x<<endl;
}
//for-Schleife
for(int i=0;i<5;i++)
{
cout<<"i="<<endl;
}
//do-while-Schleife
do
{
x++;
cout<<"x="<<x<<endl;
}while(x<5);
Code 0-3: Kontrollstrukturen
|
ÜBUNG
|
3. Wiederholung und Vertiefung zu Funktionen
|
double findeMaximum(double *array, int anzahl)
{
double ergebnis = array[0];
for(int i=1;i<anzahl;i++)
{
if(array[i]>ergebnis)
{
ergebnis = array[i];
}
}
return ergebnis;
}
Code 0-4: maximum.h
#include <iostream>
#include "maximum.h"
using namespace std;
int main(void)
{
double array[] = {-0.5,3.7,-1.5,2.5,7.3,2.1,3.0};
int anzahl = sizeof(array)/sizeof(double); //Bestimmung der Anzahl der Array-Elemente
cout<<"Array: ";
for(int i=0;i<anzahl;i++)
{
cout<<" "<<array[i];
}
cout<<endl;
cout<<"Groesstes Element:"<<findeMaximum(array,anzahl)<<endl;
return 0;
}
Code 0-5: hauptprogramm.cpp
linux@Xubuntu2004:~/Programm5_LV4_15_April$ g++ -o hauptprogramm hauptprogramm.cpp linux@Xubuntu2004:~/Programm5_LV4_15_April$ ./hauptprogramm Array: -0.5 3.7 -1.5 2.5 7.3 2.1 3 Groesstes Element:7.3
Code 0-6: Konsolen Ein- und Ausgaben
ÜBUNGEN
|
4. Rückblick auf den Feder-Masse-Schwinger
 10_Informatik1/06_Anwendungsgebiete/01_Simulationstechnik
10_Informatik1/06_Anwendungsgebiete/01_Simulationstechnik
5. Allgemeine Ergänzungen zu Simulationstechnik
 50_Simulationstechnik/01_Systemtheorie/02_Modell
50_Simulationstechnik/01_Systemtheorie/02_Modell
Preview Virtual Reality Modeling Language (VRML)
 50_Simulationstechnik/03_VRML
50_Simulationstechnik/03_VRML
6. Ein weiteres Beispiel zu Simulationstechnik: Das Räuber-Beute-Modell
siehe zur Vertiefung:
ÜBUNG
 12_Technologie/03_Lottka_Volterra
12_Technologie/03_Lottka_Volterra
|
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
{
double Raeuber_alt = 10.0;
double Raeuber_neu = 0.0;
double Beute_alt = 100.0;
double Beute_neu = 0.0;
double dt = 0.01;
double t = 0.0;
while(t<1.0)
{
cout<<Raeuber_alt<<" "<<Beute_alt<<endl;
Beute_neu = Beute_alt + (Beute_alt*1.0 - Beute_alt*Raeuber_alt*0.01)*dt;
Raeuber_neu = Raeuber_alt + (-Raeuber_alt*1.0 + Beute_alt*Raeuber_alt*0.01)*dt;
Raeuber_alt = Raeuber_neu;
Beute_alt = Beute_neu;
t+=dt;
}
return 0;
}
Code 0-7: NEUE VORLAGE ("Balken" und Verlangsamung sind zu ergänzen.)
#include <iostream>
#include <time.h>
using namespace std;
int main(void)
{
int x=0;
clock_t t_start , t_end;
t_start = clock();
for(int i=0;i<500000000;i++)
x++;
t_end = clock();
cout<<"Dauer des Prozesses in Nanosekunden: "<<(t_end-t_start)<<endl;
}
Code 0-8: Zeitmessung mit C++.
Wie kann man auf dieser Grundlage ein Programm schreiben, dass eine Schleife in einem definierten Tempo ausführt?
|
#include <iostream>
#include <time.h>
#include <math.h>
using namespace std;
int main(void)
{
double t=0.0;
double frequenz=0.1;
double y=0.0;
int amplitude=0;
clock_t tt;
tt=clock();
while(true)
{
y = sin(2.0*M_PI*frequenz*t);
amplitude = (int)round((y+1.0)*40.0);
for(int i=0;i<amplitude;i++)
cout<<"#";
cout<<endl;
t+=0.1;
while(clock()<tt+100000);
tt=clock();
}
}
Code 0-9: sinus.cpp
ÜBUNGEN
|
Themen für die Übung am 17.04.
|
if(i>5)
{
cout<<"i ist groesser als 5"<<endl;
}
if(i>5)
{
cout<<"i ist groesser als 5"<<endl;
}
else
{
cout<<"i ist kleiner oder gleich 5"<<endl;
}
if(i>5)
{
cout<<"i ist groesser als 5"<<endl;
}
else if(i==0)
{
cout<<"i ist Null"<<endl;
}
else
{
cout<<"i ist kleiner oder gleich 5, aber ungleich Null"<<endl;
}
Code 0-10: Varianten der if-Anweisung: if / else / else if.
MUSTERLÖSUNGEN
Gegebene Kontrollstrukturen einbetten:
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
{
//for-Schleife
for(int i=0;i<5;i++)
{
cout<<"i="<<i<<endl;
}//for(int i=0;i<5;i++)
return 0;
}
Code 0-11: Beispiel mit for.
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
{
int x = 0;
//while-Schleife
while(x<5)
{
x++; //Postinkrement-Operator, erhöht x um +1.
cout<<"x="<<x<<endl;
}
return 0;
}
Code 0-12: Beispiel mit while.
Räuber Beute Übung
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <time.h>
using namespace std;
int main(void)
{
double Raeuber_alt = 10.0;
double Raeuber_neu = 0.0;
double Beute_alt = 100.0;
double Beute_neu = 0.0;
double dt = 0.01;
double t = 0.0;
clock_t tt = clock();
while(true)
{
int beuterauten = (int)round(Beute_alt/4.0);
int raeuberplusse = (int)round(Raeuber_alt/4.0);
if(beuterauten<raeuberplusse)
{
for(int i=0;i<beuterauten;i++)
{
cout<<'#';
}
for(int i=beuterauten;i<=raeuberplusse;i++)
{
cout<<'+';
}
cout<<endl;
}
else
{
for(int i=0;i<raeuberplusse;i++)
{
cout<<'+';
}
for(int i=raeuberplusse;i<=beuterauten;i++)
{
cout<<'#';
}
cout<<endl;
}
Beute_neu = Beute_alt + (Beute_alt*1.0 - Beute_alt*Raeuber_alt*0.01)*dt;
Raeuber_neu = Raeuber_alt + (-Raeuber_alt*1.0 + Beute_alt*Raeuber_alt*0.01)*dt;
Raeuber_alt = Raeuber_neu;
Beute_alt = Beute_neu;
t+=dt;
while(clock()<tt+10000); //Warteschleife ohne Rumpf, wartet 0,1 Sekunde.
tt = clock(); //Aktualisieren der Systemzeit in tt.
}
return 0;
}
Code 0-13: Aktueller Stand.
Lehrveranstaltung am 22.04.2024
Veränderung der Oranisation: eine Vorlesung soll es ab jetzt immer Mittwochs geben, wohingegen der Montag Übungen vorbehalten sein soll.
|
|
Beim heutigen Stand der Leistungsfähigkeit der Computer und mit Erfindung von Deep Learning verbuchen konnektionistische Ansätze große Erfolge:
Die sich immer weiter steigernde Fähigkeit von Computersystemen, Probleme im menschlichen Umfeld zu lösen, wirft mittlerweile auch ethische Fragen auf, wie sie in der Moral Machine des MIT thematisiert werden:
VORÜBUNGEN (gemeinsame Saalübung)
Schreiben Sie jeweils ein zu dem Flussdiagrammen passendes Programm:

Bild 0-1: Countdown.
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
{
int i=10;
cout<<"Countdown:"<<endl;
while(i>=0)
{
cout<<i<<endl;
i=i-1;
}
cout<<"i am Ende: "<<i<<endl;
return 0;
}
Code 0-14: Musterlösung.
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
{
int i=10;
cout<<"Countdown:"<<endl;
do
{
cout<<i<<endl;
i=i-1;
} while(i>=0);
cout<<"i am Ende: "<<i<<endl;
return 0;
}
Code 0-15: Variante mit do-while.
Hier noch einmal die Übungsaufgabe ausformuliert:
ÜBUNG 1
Arbeitshinweise:
|
|
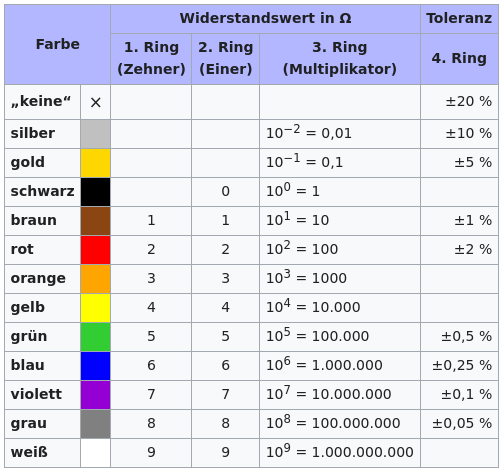
Bild 0-2: Farbkodierung von Widerständen mit 3 oder 4 Ringen, Quelle: Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement)#Farbkodierung_auf_Widerst%C3%A4nden
Bisher wurde eine Hilfestellung in Form eines Flussdiagramms gegeben, um den Code des dritten Rings aus dem Widerstandswert zu gewinnen. Dabei meint "Code" die Ausgabe der Zahl, die mit dem entsprechenden Farbwert verknüpft ist:
| Code | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|
| 0 | schwarz | 10^0 |
| 1 | braun | 10^1 |
| 2 | rot | 10^2 |
| 3 | orange | 10^3 |
| 4 | gelb | 10^4 |
| 5 | grün | 10^5 |
| 6 | blau | 10^6 |
| 7 | lila | 10^7 |
| 8 | grau | 10^8 |
| 9 | weiss | 10^9 |
Tabelle 0-1: Zuordnung Code, Farbe, Bedeutung beim dritten Ring.

Bild 0-3: Hilfestellung: Flussdiagramm, um den Code des dritten Rings zu bestimmen.
Entwickeln Sie das Programm in aufeinander aufbauenden Stufen:
|
Musterlösung
#include <iostream>
using namespace std;
void gibFarbcodeAus(int code)
{
if(code==0)
cout<<"schwarz";
else if(code==1)
cout<<"braun";
else if(code==2)
cout<<"rot";
else if(code==3)
cout<<"orange";
else if(code==4)
cout<<"gelb";
else if(code==5)
cout<<"gruen";
else if(code==6)
cout<<"blau";
else if(code==7)
cout<<"violett";
else if(code==8)
cout<<"grau";
else //if(code==9)
cout<<"weiss";
}
int main(void)
{
int wert = 0;
int code = 0;
cout<<"Geben Sie den Widerstandswert in Ohm an:";
cin>>wert;
cout<<endl;
//Code des dritten Rings bestimmen:
while(wert>100)
{
wert = wert/10;
code = code + 1;
}
int zweiter_ring = wert - (wert/10)*10;
cout<<"Code erster Ring: "<<(wert/10)<<" (";
gibFarbcodeAus((wert/10));
cout<<")"<<endl;
cout<<"Code zweiter Ring: "<<zweiter_ring<<" (";
gibFarbcodeAus(zweiter_ring);
cout<<")"<<endl;
cout<<"Code dritter Ring: "<<code<<" (";
gibFarbcodeAus(code);
cout<<")"<<endl;
return 0;
}
Code 0-16: Musterlösung
Musterlösung mit Schleife
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
{
int wert = 0;
int code = 0;
int erster_ring = 0;
cout<<"Geben Sie den Widerstandswert in Ohm an:";
cin>>wert;
cout<<endl;
//Code des dritten Rings bestimmen:
while(wert>100)
{
wert = wert/10;
code = code + 1;
}
//Code des ersten Rings bestimmen:
while(wert>10)
{
wert = wert-10;
erster_ring = erster_ring + 1;
}
cout<<erster_ring<<" "<<wert<<" "<<code<<endl;
return 0;
}
Code 0-17: Musterlösung mit Schleife
Musterlösung mit Modulo
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
{
int wert = 0;
int code = 0;
cout<<"Geben Sie den Widerstandswert in Ohm an:";
cin>>wert;
cout<<endl;
//Code des dritten Rings bestimmen:
while(wert>100)
{
wert = wert/10;
code = code + 1;
}
// int zweiter_ring = wert - (wert/10)*10;
int zweiter_ring = wert%10;
cout<<"Code erster Ring: "<<(wert/10)<<endl;
cout<<"Code zweiter Ring: "<<zweiter_ring<<endl;
cout<<"Code dritter Ring: "<<code<<endl;
return 0;
}
Code 0-18: Musterlösung mit Modulo
ÜBUNG 2
|